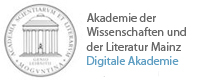Deutsche Inschriften Online
 Seit heute ist die digitale Ausgabe der Reihe „Die Deutschen Inschriften“ unter www.inschriften.net online. Fünf Bände sind bereits verfügbar, weitere sollen im Laufe des Sommers hinzukommen. Für das Projekt „Deutsche Inschriften Online“ (kurz DIO) wurde – wie auch beim Pilotprojekt „Inschriften Mittelrhein-Hunsrück“ – das Content Management System TYPO3 benutzt. Alle Einträge der bereits online gestellten fünf Bände sind mitsamt Bildmaterial, das zum Teil das des gedruckten Bandes erheblich erweitert, kostenfrei abrufbar. Das Projekt wurde von den Akademien der Wissenschaften in Mainz und Göttingen realisiert.
Seit heute ist die digitale Ausgabe der Reihe „Die Deutschen Inschriften“ unter www.inschriften.net online. Fünf Bände sind bereits verfügbar, weitere sollen im Laufe des Sommers hinzukommen. Für das Projekt „Deutsche Inschriften Online“ (kurz DIO) wurde – wie auch beim Pilotprojekt „Inschriften Mittelrhein-Hunsrück“ – das Content Management System TYPO3 benutzt. Alle Einträge der bereits online gestellten fünf Bände sind mitsamt Bildmaterial, das zum Teil das des gedruckten Bandes erheblich erweitert, kostenfrei abrufbar. Das Projekt wurde von den Akademien der Wissenschaften in Mainz und Göttingen realisiert.
Workshop „Digitale Urkundenpräsentationen“
Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte und am Bayerischen Hauptstaatsarchiv angesiedelte Projekt „Urkundenportal“ ist im März 2010 nach insgesamt 24 Monaten Laufzeit abgeschlossen worden. Dies nimmt die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zum Anlass, im Rahmen eines eintägigen Workshops am 16. Juni in München die Ergebnisse dieses umfangreichen Digitalisierungs- und Erschließungsprojekts der Fachöffentlichkeit zu präsentieren. Zugleich sollen weitere derzeit laufende Projekte bzw. Urkundenpräsentationen aus dem In- und Ausland vorgestellt werden. In einem zweiten Themenblock werden ausgewählte technische Fragen und Aspekte des sog. Web 2.0 bzw. der kollaborativen Bearbeitung von Urkunden behandelt; ebenso soll ein Blick auf die (mögliche) Zukunft der Urkundendigitalisierung im archivischen Bereich geworfen werden. Während des Workshops wird ausreichend Zeit für eine Diskussion der Referate sein. [Mehr Informationen auf H-Soz-u-Kult]
THATCamp in Paris
In Paris findet vom 18. bis zum 19. Mai 2010 das erste europäische „The Humanities And Technology Camp“ (THATCamp) statt, organisiert vom Centre pour l’édition électronique ouverte (CLEO). Das THATCamp ist eine „Unkonferenz“, bei der die Teilnehmer ausdrücklich aufgefordert sind, durch eigene Vorträge und Workshops ihr Wissen und ihre Erfahrung einzubringen. Das Ziel des THATCamps ist es, so die Organisatoren, „to participate to the developement of the Digital Humanities community“. Die Workshops sollen vorwiegend in Englisch gehalten werden, da neben französischem Publikum explizit auch Wissenschaftler/-innen und Informatiker/-innen aus anderen europäischen Staaten eingeladen sind. Den ganzen Beitrag lesen
Digitale Pacelli-Edition online
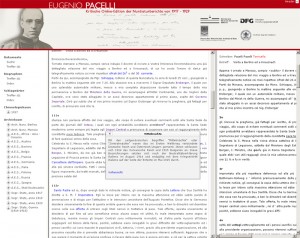 Letzten Mittwoch wurde die „Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte von Eugenio Pacelli 1917-1929“ mit den ersten Dokumenten freigeschaltet. Die Pacelli-Edition setzt auf die von den Deutschen Historischen Instituten in Rom und London entwickelte Software „DENQ – Digitale Editionen Neuzeitlicher Quellen“, die schon für zwei andere Editionsprojekte eingesetzt wurde. Im Wesentlichen basiert DENQ auf einer Open-Source-XML-Datenbank, die durch PHP- und Java-Module erweitert wurde. Für die nun veröffentlichte Online-Edition wurde DENQ in zwei wichtigen Punkten weiterentwickelt. Den ganzen Beitrag lesen
Letzten Mittwoch wurde die „Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte von Eugenio Pacelli 1917-1929“ mit den ersten Dokumenten freigeschaltet. Die Pacelli-Edition setzt auf die von den Deutschen Historischen Instituten in Rom und London entwickelte Software „DENQ – Digitale Editionen Neuzeitlicher Quellen“, die schon für zwei andere Editionsprojekte eingesetzt wurde. Im Wesentlichen basiert DENQ auf einer Open-Source-XML-Datenbank, die durch PHP- und Java-Module erweitert wurde. Für die nun veröffentlichte Online-Edition wurde DENQ in zwei wichtigen Punkten weiterentwickelt. Den ganzen Beitrag lesen
Tagungsbericht: Virtuelle Forschungsplattformen
Der Bericht zur Tagung „Virtuelle Forschungsplattformen in den Geisteswissenschaften – Anforderungen, Probleme, Lösungsansätze“ (21./22.10.2009) hat Gisela Minn (Universität Trier) vor kurzem bei H-Soz-u-Kult eingestellt. Nach einem Überblick über die verschiedenen Vorträge, fass Minn das gemischte Ergebnis der Tagung zusammen: „Mit einigem Recht kann man feststellen, dass die Basisinfrastruktur für die computergestützte Forschungsarbeit in wesentlichen Teilbereichen besteht. […] Dennoch war man sich im Erfahrungsaustausch auch darüber einig, dass es zu einer koordinierten Strategie und verstärkter gemeinsamer Anstrengungen bedarf, um eine breitere Akzeptanz der computergestützten Forschungsarbeit zu erzielen un den Weg für Forschungen in den e-Humanities zu bahnen“. Angesicht der mittlerweile großen – prinzipiell zu begrüßenden – Vielfalt der Projekte in diesem Bereich, wurde auch eine „institutsgrenzenüberschreitende Kooperation zur Entwicklung gemeinsamer Standards und zur Schonung von Ressourcen“ angemahnt. Der Weg zu einem virtuellen Arbeitsplatz sei noch weit, aber ein wesentlicher Schritt in diese Richtung sei getan.
Tagungsbericht auf H-Soz-u-Kult
Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter
Der Frage, wie stark sich paläographische und kodikologische Forschung durch moderne Informationstechnologien verändert, ging im Juli letzten Jahres die Tagung „Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter“ in München nach. Neue Forschungsfragen würden durch die technischen Weiterentwicklungen derzeit nicht geliefert werden, vielmehr arbeite man die alten Fragen ab, berichtet Georg Vogeler in seinem Tagungsbericht auf H-Soz-u-Kult (23.02.2010). Dabei ließen sich allerdings mit Hilfe des Computers neue Antworten finden. Kritisch angemerkt wurde aber, dass sich Softwarelösungen den Wissenschaftlern manchmal als „Black Box“ darstellten. Der Einsatz von Open-Source-Lösungen sowie eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Informatikern sollen dem entgegenwirken. Diskutiert wurde auch, dass dem Computer bestimmte Methoden – besonders aus dem kunsthistorischen und musikwissenschaftlichen Bereich – verschlossen blieben. Dem wurde gegenüber gestellt, dass mittlerweile „nicht nur binär konzipierte Fragen beantwortbar seien, sondern [der Rechnereinsatz] ausdrücklich auch „graue“ Ergebnisse liefern könne“.
Neben dem Tagungsbericht dürfte auch der bereits im Dezember in der Schriftenreihe des Instituts für Dokumentologie und Editorik erschienene Sammelband „Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter“ interessant sein. Er ist auf dem Kölner Universitäts-Publikations-Server abrufbar.
Online-Zeitschrift zur Altertumskunde zieht Bilanz
Seit März 2006 erscheint dreimal jährlich die „Frankfurter elektronische Rundschau zur Altertumskunde“ (FeRA) kostenfrei zugänglich im Internet. Das Online-Journal wendet sich vor allem an Nachwuchswissenschaftler/-innen und ist thematisch sehr breit aufgestellt. Die Herausgeber, Stefan Krmnicek (Universität Frankfurt) und Peter Probst (Universität Hamburg), zogen nun in einem Beitrag zur 10. Ausgabe eine Bilanz, die gemischt ausfällt. Auf der einen Seite hätten „die Zeitschriftenbeiträge dank der online-Zugriffsmöglichkeit eine große Verbreitung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Fachkreise gefunden“. Auf der anderen Seite stellten die Herausgeber fest, dass im „Gegensatz zu dem großen Interesse der Leserschaft […] die Menge der eingereichten Manuskripte geringer als erwartet“ war. Die Ursache sehen Krmnicek und Probst im immer größer werdenden Zeitdruck für Doktoranden sowie in der immer noch zögerlichen Bereitschaft der Wissenschaftler/-innen im Internet zu publizieren.
Workshop „History turns digital“
Im Rahmen des Projektes „Zwangsarbeit 1939–1945. Erinnerungen und Geschichte“ wird vom Lehrstuhl für Geschichte Ostmitteleuropas am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin am 16. April ein eintägiger Workshop zum Thema „History turns digital“ organisiert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung werden die Veränderungen stehen, die das Medium Internet in der Erinnerungskultur sowie der Geschichtsvermittlung und –forschung bewirkt. Dieses neue und innovative Medium der Geschichtsvermittlung und –auseinandersetzung wurde bisher kaum analysiert und ist in seinen Auswirkungen noch weitgehend unerforscht. Werden durch Interaktivität, Intermedialität und neue Formen der Kommunikation tatsächlich neue historische Narrative geschaffen und inwieweit verändert sich dadurch zugleich auch die Rezeption von Geschichte? Den ganzen Beitrag lesen
Zotero 2.0 verfügbar
Seit gestern ist die stabile Version 2.0 von Zotero verfügbar. Zotero ist ein Add-on für den Browser Firefox, mit dessen Hilfe gedruckte Literatur, sowie Webseiten und PDFs verwaltet bzw. gespeichert werden können. Außerdem können Notizen hinzugefügt werden. Plugins für Microsoft Word und Open Office erlauben das Zitieren von in Zotero gespeicherten Titeln aus den gängigen Textanwendungen heraus. Neu in Version 2.0 sind u.a. die Synchronisierungsfunktionen, um von mehreren Rechnern Zugriff auf die eigene Bibliothek zu haben sowie die Möglichkeit, „Gruppen“ auf zotero.org einzurichten, um kollaborativ Bibliographien zu erstellen und öffentlich zugänglich zu machen.
Zotero wird vom „Center for History and New Media“ an der George Mason University in der Nähe von Washington D.C. entwickelt und unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht.
Neu im Web: Docupedia-Zeitgeschichte
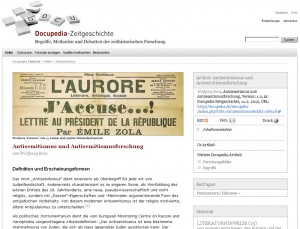 Am 11. Februar ist die schon länger angekündigte Website „Docupedia-Zeitgeschichte“ online gegangen. Sie will als Nachschlagewerk für Wissenschaftler und Studenten Begriffe, Methoden und Debatten der zeithistorischen Forschung darstellen. Die Website wurde mit der freien Software „MediaWiki“ realisiert, auf der auch die Wikipedia basiert. Im Gegensatz zur freien Enzyklopädie möchte Docupedia-Zeitgeschichte allerdings vor allem als Angebot von und für Wissenschaftler/-innen fungieren. Die zu veröffentlichenden Aufsätze werden daher vorher von den Herausgebern begutachtet. Außerdem behalten die Autoren aus demselben Grund die volle Kontrolle über ihre Texte. Die Aufsätze können zwar von Lesern kommentiert werden, allerdings erst mit einem entsprechenden Account bei „Clio online“. Größere Kommentare kann die Redaktion als Co-Beiträge zum eigentlichen Aufsatz dauerhaft zur Verfügung stellen.
Am 11. Februar ist die schon länger angekündigte Website „Docupedia-Zeitgeschichte“ online gegangen. Sie will als Nachschlagewerk für Wissenschaftler und Studenten Begriffe, Methoden und Debatten der zeithistorischen Forschung darstellen. Die Website wurde mit der freien Software „MediaWiki“ realisiert, auf der auch die Wikipedia basiert. Im Gegensatz zur freien Enzyklopädie möchte Docupedia-Zeitgeschichte allerdings vor allem als Angebot von und für Wissenschaftler/-innen fungieren. Die zu veröffentlichenden Aufsätze werden daher vorher von den Herausgebern begutachtet. Außerdem behalten die Autoren aus demselben Grund die volle Kontrolle über ihre Texte. Die Aufsätze können zwar von Lesern kommentiert werden, allerdings erst mit einem entsprechenden Account bei „Clio online“. Größere Kommentare kann die Redaktion als Co-Beiträge zum eigentlichen Aufsatz dauerhaft zur Verfügung stellen.
Die Website wird vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam in Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität zu Berlin betrieben und betreut. Das Projekt wird von der DFG gefördert.
Die neue „Docupedia-Zeitgeschichte“ ist auch Thema eines Werkstattgesprächs in der Staatsbibliothek Berlin am 25. Februar.